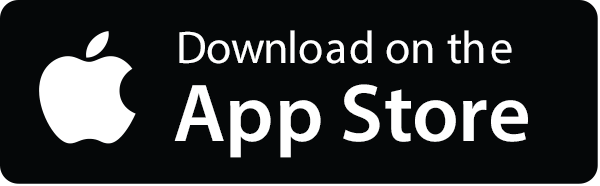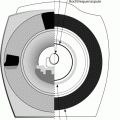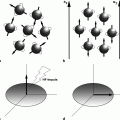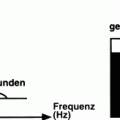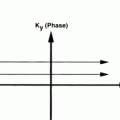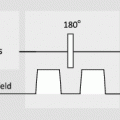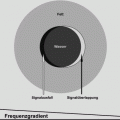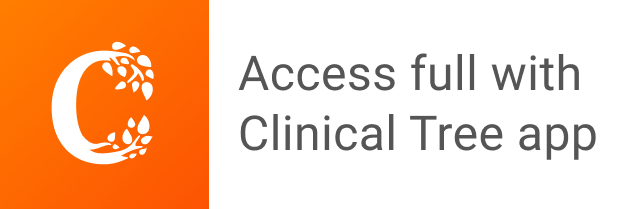(1)
Institut für Radiologie, Stadtspital Triemli, Birmensdorferstraße 497, 8063 Zürich, Schweiz
Zusammenfassung
Gehen wir noch einmal alle Schritte einer MR-Sequenz einzeln durch:
Anregung
Einschalten des Schichtwahlgradienten
Anregungsimpuls (HF-Puls)
Ausschalten des Schichtwahlgradienten
Phasenkodierung
Einschalten des Phasenkodiergradienten für eine kurze Zeit, jedes Mal mit anderer Stärke
Echoerzeugung
Messung
Einschalten des Frequenzgradienten
Empfang des Echos
Diese Schritte müssen, wie gesagt, viele Male wiederholt werden, in Abhängigkeit von der gewünschten Bildqualität. Im MRI gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Sequenzen zur Bildgebung. Drei davon spielen immer noch eine große Rolle: Die Spinecho(SE)-Sequenz, die Inversion-Recovery(IR)- und die Gradientenecho(GRE)-Sequenz, welche wir zusammen als Basis-Pulssequenzen bezeichnen.
Vom Echo haben wir bereits gesprochen (▶ Kap. 3) und auch erwähnt, dass eine definierte minimale Zeit verstreichen muss, bis nach einer Anregung die Messung des MR-Signals erfolgen kann. Nun kennen wir auch die Gründe dafür:
Der Phasenkodiergradient muss für eine bestimmte Zeit eingeschaltet werden, um die Ortskodierung zu ermöglichen.
Das Ausschalten des Schichtwahl- und das Einschalten des Frequenzkodiergradienten braucht ebenfalls etwas Zeit.
Die Erzeugung des Echos ist je nach Sequenz unterschiedlich zeitraubend.
Die beiden Sequenzen, die wir nun besprechen wollen, unterscheiden sich vor allem durch die Art, in der das Echo erzeugt wird.
Gehen wir noch einmal alle Schritte einer MR-Sequenz einzeln durch:
Anregung
Einschalten des Schichtwahlgradienten
Anregungsimpuls (HF-Puls)
Ausschalten des Schichtwahlgradienten
Phasenkodierung
Einschalten des Phasenkodiergradienten für eine kurze Zeit, jedes Mal mit anderer Stärke
Echoerzeugung
Messung
Einschalten des Frequenzgradienten
Empfang des Echos
Diese Schritte müssen, wie gesagt, viele Male wiederholt werden, in Abhängigkeit von der gewünschten Bildqualität. Im MRI gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Sequenzen zur Bildgebung. Drei davon spielen immer noch eine große Rolle: Die Spinecho(SE)-Sequenz, die Inversion-Recovery(IR)- und die Gradientenecho(GRE)-Sequenz, welche wir zusammen als Basis-Pulssequenzen bezeichnen.
Vom Echo haben wir bereits gesprochen (▶ Kap. 3) und auch erwähnt, dass eine definierte minimale Zeit verstreichen muss, bis nach einer Anregung die Messung des MR-Signals erfolgen kann. Nun kennen wir auch die Gründe dafür:
Der Phasenkodiergradient muss für eine bestimmte Zeit eingeschaltet werden, um die Ortskodierung zu ermöglichen.
Das Ausschalten des Schichtwahl- und das Einschalten des Frequenzkodiergradienten braucht ebenfalls etwas Zeit.
Die Erzeugung des Echos ist je nach Sequenz unterschiedlich zeitraubend.
Die beiden Sequenzen, die wir nun besprechen wollen, unterscheiden sich vor allem durch die Art, in der das Echo erzeugt wird.
7.1 Spinechosequenz
Bei der Spinechosequenz erfolgt die Anregung mit einem schichtselektiven 90°-RF-Impuls. Danach zerfällt die transversale Magnetisierung mit T2 und T2* (▶ Kap. 2): Aufgrund statischer, d. h. immer identisch starker Feldinhomogenitäten laufen einige Spins schneller als andere und es kommt zur Dephasierung . Nachdem die Hälfte der gewünschten Echozeit (TE•0,5) verstrichen ist, wird ein 180°-Impuls gesendet. Er kehrt die Reihenfolge der Spins um: Diejenigen, die vorher zuvorderst waren, sind nun am weitesten hinten und umgekehrt. Da erstere aber wiederum schneller laufen als die anderen (die Feldinhomogenitäten, die den Unterschied verursachten, sind ja immer noch da!), holen sie wieder auf und nachdem die zweite Hälfte der Echozeit TE verstrichen ist, treffen sich alle wieder in Phase: Es kommt zum Echo (◘ Abb. 7.1).

Abb. 7.1
Spinechosequenz: Der Pulswinkel beträgt immer 90°, das Echo wird mit einem 180°-Impuls erzeugt. Schematische Darstellung der verschiedenen Stufen des Phasengradienten (gestrichelte Linien)
Durch die Einstrahlung des 180°-Refokussierungspulses werden die statischen Magnetfeldinhomogenitäten praktisch korrigiert, um ein T2-gewichtetes Echo zu erhalten. Eine ähnliche Situation werden wir auch bei den Bewegungs- und Flussartefakten antreffen.
Der Vorteil der Spinechosequenz liegt genau in ihrer Unempfindlichkeit gegenüber statischen Feldinhomogenitäten und in der daraus resultierenden sehr guten Bildqualität; ihr Nachteil ist jedoch eine recht lange Messzeit und deshalb auch eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Bewegungsartefakten. Spinechosequenzen gehören heute immer noch zu den Standardsequenzen für T1-gewichtete Bilder oder für PD- (intermediär) gewichtete Bilder. Allerdings werden T1- und PD-gewichtete Bilder auch zunehmend mit schnellen („fast“) Spinechosequenzen akquiriert.
7.2 Outflow-Effekt
Eine spezifische Erscheinung der Spinechosequenzen ist der Outflow-Effekt. Er bewirkt, dass sich die Blutgefäße in der Regel schwarz, also ohne Signal, darstellen. Der Grund dafür liegt in der verhältnismäßig langen Echozeit. Während sie verstreicht, geschehen zwei Dinge:
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree