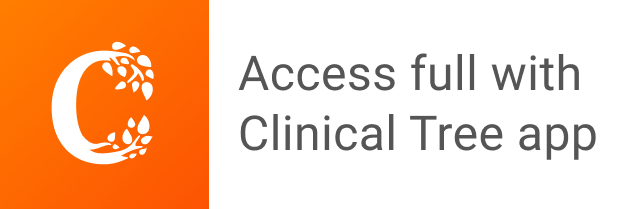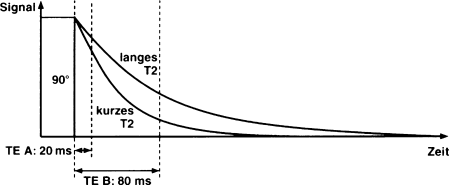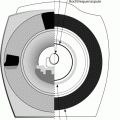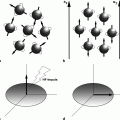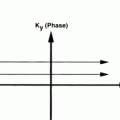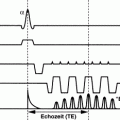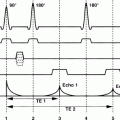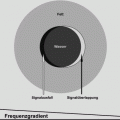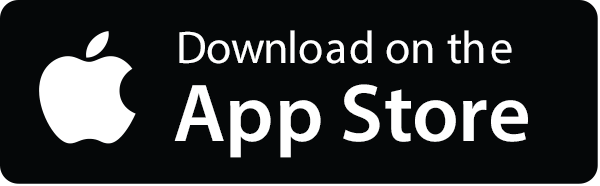(1)
Institut für Radiologie, Stadtspital Triemli, Birmensdorferstraße 497, 8063 Zürich, Schweiz
Zusammenfassung
Wovon hängt der Bildkontrast im MR-Bild ab, und wie können wir ihn beeinflussen? Jetzt, wo wir über Anregung und Relaxation Bescheid wissen, können wir diese Fragen beantworten. Drei Parameter eines Gewebes bestimmen dessen Helligkeit im MR-Bild und damit den Bildkontrast:
Die Protonendichte, also die Anzahl anregbarer Spins pro Volumeneinheit, gibt quasi das Signalmaximum an, das ein Gewebe abgeben kann. Die Protonendichte kann betont werden, indem man versucht, den Einfluss der beiden anderen Parameter (T1 und T2) möglichst gering zu halten. Man spricht dann von protonengewichteten oder dichtegewichteten Bildern („proton density weighted“).
Die T1-Zeit eines Gewebes bestimmt, wie schnell sich die Spins von einer Anregung „erholen“ und erneut anzuregen sind. Damit wird indirekt die Signalintensität beeinflusst. Der Einfluss von T1 auf den Bildkontrast kann nach Belieben variiert werden. Bilder, deren Kontrast hauptsächlich von T1 bestimmt wird, nennt man T1-gewichtet (T1w).
Die T2-Zeit bestimmt im Wesentlichen, wie rasch das MR-Signal nach einer Anregung abklingt. Auch der T2-Kontrast eines Bildes kann beeinflusst werden. Bilder, deren Kontrast vor allem von T2 bestimmt wird, heißen entsprechend T2-gewichtet (T2w).
Wovon hängt der Bildkontrast im MR-Bild ab, und wie können wir ihn beeinflussen? Jetzt, wo wir über Anregung und Relaxation Bescheid wissen, können wir diese Fragen beantworten. Drei Parameter eines Gewebes bestimmen dessen Helligkeit im MR-Bild und damit den Bildkontrast:
Die Protonendichte, also die Anzahl anregbarer Spins pro Volumeneinheit, gibt quasi das Signalmaximum an, das ein Gewebe abgeben kann. Die Protonendichte kann betont werden, indem man versucht, den Einfluss der beiden anderen Parameter (T1 und T2) möglichst gering zu halten. Man spricht dann von protonengewichteten oder dichtegewichteten Bildern („proton density weighted“).
Die T1-Zeit eines Gewebes bestimmt, wie schnell sich die Spins von einer Anregung „erholen“ und erneut anzuregen sind. Damit wird indirekt die Signalintensität beeinflusst. Der Einfluss von T1 auf den Bildkontrast kann nach Belieben variiert werden. Bilder, deren Kontrast hauptsächlich von T1 bestimmt wird, nennt man T1-gewichtet (T1w).
Die T2-Zeit bestimmt im Wesentlichen, wie rasch das MR-Signal nach einer Anregung abklingt. Auch der T2-Kontrast eines Bildes kann beeinflusst werden. Bilder, deren Kontrast vor allem von T2 bestimmt wird, heißen entsprechend T2-gewichtet (T2w).
Protonendichte, T1 und T2 sind spezifische Merkmale, anhand derer sich verschiedene Gewebe teilweise sehr stark unterscheiden. Je nachdem, welcher Parameter in einer MR-Messsequenz betont wird, entstehen Bilder mit unterschiedlichem Gewebe-zu-Gewebe-Kontrast. Darin liegt das Geheimnis des großen diagnostischen Potenzials des MRI: Bereits ohne Kontrastmittel ist es möglich, Gewebe aufgrund ganz spezifischer Merkmale voneinander abzugrenzen, die beispielsweise in der Computertomographie (CT) praktisch nicht unterscheidbar sind.
3.1 Repetitionszeit und T1-Gewichtung
Um ein MR-Bild zu erhalten, muss eine Schicht viele Male nacheinander angeregt und gemessen werden. Die Gründe dafür werden später erläutert (▶ Kap. 4).
Die Zeit, die zwischen zwei aufeinander folgenden Anregungen derselben Schicht verstreicht, nennen wir Repetitionszeit.
Die Repetitionszeit („time repetition“; TR) beeinflusst entscheidend den T1-Kontrast, denn sie bestimmt, wie lange die Spins Zeit haben, sich von der letzten Anregung zu „erholen“. Je länger dies dauert, desto weiter kippen die angeregten Spins in die Z-Richtung zurück und desto mehr Längsmagnetisierung steht bei der nächsten Anregung zur Verfügung. Eine stärkere Magnetisierung ergibt aber auch ein größeres Signal nach der nächsten Anregung.
Wird die Repetitionszeit kurz gewählt (<600 ms), so beeinflusst T1 wesentlich den Bildkontrast (◘ Abb. 3.1: TR A). Gewebe mit kurzem T1 relaxieren rasch und erzeugen nach einer erneuten Anregung ein starkes Signal (erscheinen also im Bild hell). Gewebe mit langem T1 sind hingegen noch gering relaxiert und stellen nur wenig Längsmagnetisierung zur Verfügung. Sie erzeugen deshalb ein schwächeres Signal als Gewebe mit kurzem T1 und erscheinen im Bild dunkel. Ein solches Bild enthält also einen hohen Anteil an T1-Information, es ist T1-gewichtet.
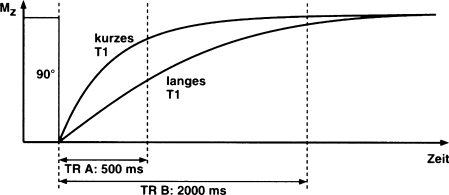
Abb. 3.1
Schematische Darstellung von Repetitionszeit und der T1-Kontrast: Bei kurzem TR (A) weist ein Gewebe mit kurzem T1 bereits wieder eine starke Längsmagnetisierung auf und gibt ein größeres Signal ab, während ein Gewebe mit langem T1 noch ein geringes Signal erzeugt. Bei langem TR (B) haben beide Gewebe eine ähnlich große Magnetisierung aufgebaut und geben ein etwa gleich intensives Signal ab
Wird die Repetitionszeit hingegen relativ lang gewählt (>1500 ms), so haben alle Gewebe, auch jene mit langem T1, genügend Zeit zu relaxieren; alle geben ein ähnlich intensives Signal ab (◘ Abb. 3.1: TR B). Der T1-Einfluss auf den Bildkontrast ist also nur noch gering, die T1-Gewichtung hat abgenommen.
Durch die Wahl der Repetitionszeit lässt sich also die T1-Gewichtung bestimmen.
Kurze Repetitionszeit: starke T1-Gewichtung
Lange Repetitionszeit: geringe T1-Gewichtung
Zusammenhang Repetitionszeit und T1-Kontrast:
Gewebe mit kurzer T1 erscheinen auf T1-gewichteten Bildern hell, weil sie sich rascher erholen und deshalb ein stärkeres Signal erzeugen.
Gewebe mit langer T1 erscheinen auf T1-gewichteten Bildern dunkel, weil sie weniger rasch relaxieren und deshalb ein schwächeres Signal erzeugen.
3.2 Echozeit und T2-Gewichtung
Was ist überhaupt ein Echo?
Im ▶ Kap. 4 werden wir sehen, dass bei einer MR-Messung verschiedene Gradientenspulen ein- und ausgeschaltet werden müssen, um ein Bild zu erhalten. Im Moment genügt es zu wissen, dass diese Gradienten Magnetfeldinhomogenitäten bewirken und deshalb die T2- und T2*-Effekte noch verstärken: Sie bringen die angeregten Spins außer Phase und zerstören damit das MR-Signal. Vor der Messung müssen diese Effekte der Dephasierung zuerst rückgängig gemacht werden, damit die Spins wieder in Phase kommen. Wenn dies geschehen ist und das Signal wiederhergestellt wird, sprechen wir von einem Echo. Jetzt können wir das MR-Signal messen.
Die Echozeit ist diejenige Zeitspanne, die man nach der Anregung bis zur Messung des MR-Signals verstreichen lässt.
Die Echozeit („time echo“; TE) bestimmt den Einfluss von T2 auf den Bildkontrast, dabei ist T2, wie bereits erwähnt, viel kürzer als T1 und liegt im Bereich von bis zu einigen Hundert Millisekunden.
Wird die Echozeit kurz gewählt (<30 ms), so sind die Signalintensitätsunterschiede noch klein (◘ Abb. 3.2: TE A). Die T2-Relaxation hat eben erst begonnen, und die Signale sind noch nicht stark abgeklungen. Entsprechend ist die T2-Gewichtung eines solchen Bildes gering.