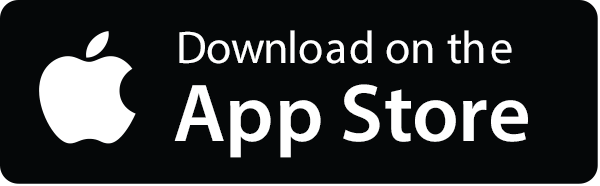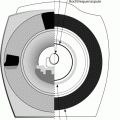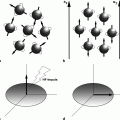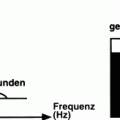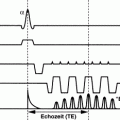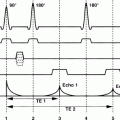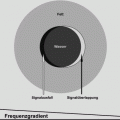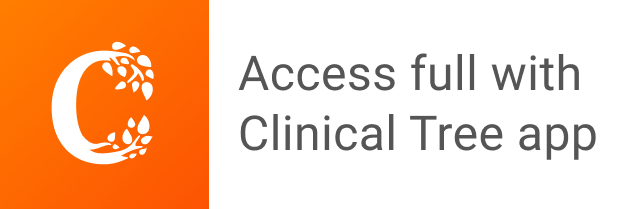(1)
Institut für Radiologie, Stadtspital Triemli, Birmensdorferstraße 497, 8063 Zürich, Schweiz
Zusammenfassung
Wir haben nun das MR-Phänomen, die Relaxation und die Bedeutung von Repetitions- und Echozeiten besprochen. Jetzt möchten wir endlich ein Bild machen! MRI ist ein tomographisches Verfahren, d. h. es werden Schnittbilder durch den Körper angefertigt. Das beginnt damit, dass wir mit dem Anregungsimpuls nicht den ganzen Körper, sondern gezielt nur die Schicht erfassen, die wir untersuchen wollen. Wie gelingt dies und wie erhalten wir aus dem MR-Signal Informationen über dessen Herkunft innerhalb der Schicht?
Wir haben nun das MR-Phänomen, die Relaxation und die Bedeutung von Repetitions- und Echozeiten besprochen. Jetzt möchten wir endlich ein Bild machen! MRI ist ein tomographisches Verfahren, d. h. es werden Schnittbilder durch den Körper angefertigt. Das beginnt damit, dass wir mit dem Anregungsimpuls nicht den ganzen Körper, sondern gezielt nur die Schicht erfassen, die wir untersuchen wollen. Wie gelingt dies und wie erhalten wir aus dem MR-Signal Informationen über dessen Herkunft innerhalb der Schicht?
4.1 Schichtwahl
Wir wollen als Beispiel eine transversale (axiale) Schicht akquirieren, also einen Querschnitt durch den Körper. In den meisten MR-Tomographen verläuft das Magnetfeld nicht von oben nach unten, wie dies in den bisherigen Abbildungen gezeigt wurde, sondern entlang des Körpers der untersuchten Person. Deshalb wird diese Richtung in den nachfolgenden Abbildungen als „Z“ bezeichnet, denn wir haben bereits festgestellt: Z ist immer die Richtung des Magnetfeldes. Die Magnetfeldgradienten , von denen wir gleich sprechen werden, sind durch Keile dargestellt: die Magnetfeldstärke ist dabei proportional zur Stärke des Keils.
Sowohl die selektive Anregung einer Schicht als auch die Verschlüsselung des Signalherkunftsorts basieren auf der Tatsache, dass die Präzessions- oder Larmorfrequenz proportional zur Magnetfeldstärke ist. Außerdem erinnern wir uns, dass eine Anregung nur erfolgt, wenn die Anregungsfrequenz ungefähr der Larmorfrequenz entspricht (Resonanz ). Solange das Magnetfeld über den ganzen Körper hinweg gleich stark (also homogen) ist, haben alle Spins genau dieselbe Larmorfrequenz; mit einem Anregungsimpuls würde deshalb immer der ganze Körper gleichzeitig angeregt.
Um aber eine Schicht selektiv anzuregen, muss das Magnetfeld entlang der Z-Richtung inhomogen sein. Hierfür verwenden wir eine zusätzliche Magnetspule, die das Magnetfeld am Kopfende des Tomographen etwas verstärkt, am Fußende dagegen etwas abschwächt. Anstatt homogen zu sein, weist das Magnetfeld also jetzt einen Gradienten (Anstieg) entlang der Z-Richtung auf, weshalb jetzt auch die Larmorfrequenz der Spins am Kopfende höher ist als am Fußende. Hieraus resultiert eine fließende Änderung der Larmorfrequenzen entlang der Z-Richtung; jede Schicht besitzt nun eine eigene, von den anderen Schichten jeweils verschiedene Frequenz. So können wir mit einer bestimmten Frequenz genau eine ausgewählte Schicht anregen; der Rest des Körpers wird nicht beeinflusst (◘ Abb. 4.1).
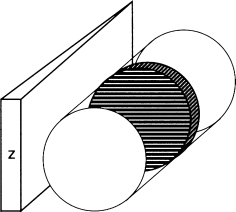
Abb. 4.1
Schematische Darstellung der Schichtwahl durch den Z-Gradienten: Mit einer definierten Frequenz wird genau eine bestimmte Schicht (schraffiert) angeregt, die angrenzenden Schichten besitzen andere Resonanzfrequenzen und werden nicht beeinflusst
Gradienten sind somit eigene Magnetfelder, welche das Hauptmagnetfeld überlagern und durch Gradientenspulen erzeugt werden. Die Protonen in den verschiedenen Schichten sind somit vorübergehend unterschiedlich starken Magnetfeldern ausgesetzt und weisen damit auch unterschiedliche Präzessionsfrequenzen auf. Die Schichtdicke wird durch einen Wechsel der Gradientenstärke des Schichtwahlgradienten geändert: Eine geringere Gradientenstärke ergibt dickere Schichten, währenddessen starke Gradienten zur Erzeugung von dünnen Schichten gebraucht werden (◘ Abb. 4.2a). Die Schichtposition wird durch eine Änderung der Frequenzbandbreite des RF-Impulses verändert (◘ Abb. 4.2b).
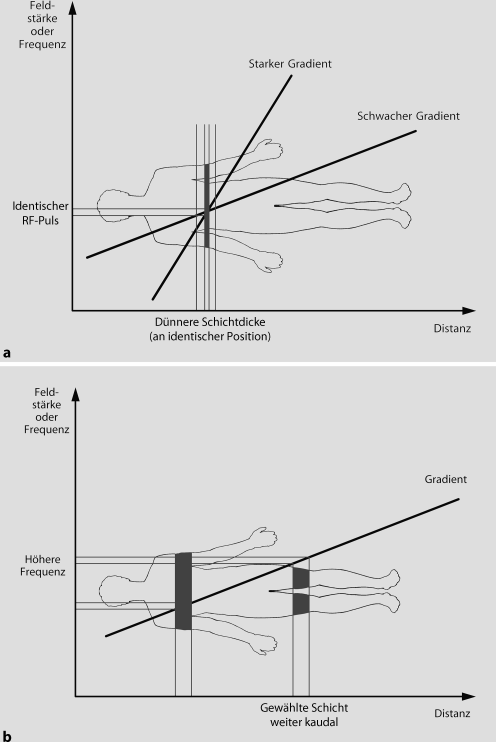
Abb. 4.2
a Schematische Darstellung des Einflusses von starken respektive schwachen Gradienten auf die Schichtdicke: Bei identischer Frequenzbandbreite des RF-Impulses ergibt sich mit einem stärkeren Schichtgradienten eine dünnere Schichtdicke. Umgekehrt ergibt ein schwächerer Gradient eine dickere Schicht. b Beeinflussung der Schichtposition durch die Frequenzwahl des RF-Pulses
Stay updated, free articles. Join our Telegram channel

Full access? Get Clinical Tree